Der Moro-Reflex ist einer der beiden Stressschutzreflexe. Er entwickelt sich ab der 12. Schwangerschaftswoche und sollte bis zum 3.–4. Lebensmonat gehemmt bzw. integriert sein. Typisch ist seine automatische, unbewusste Reaktion auf plötzliche Veränderungen in der Körperlage oder auf unerwartete Reize.
Inhalt
Reflexmuster
Der Moro-Reflex wird durch plötzliche Reize ausgelöst – laute Geräusche, schnelle Lageveränderungen oder Lichtreize. Typisch ist eine „Schreckreaktion“: Die Arme schnellen zur Seite und dann wieder zur Körpermitte, oft begleitet von einem Einatmen oder Weinen.
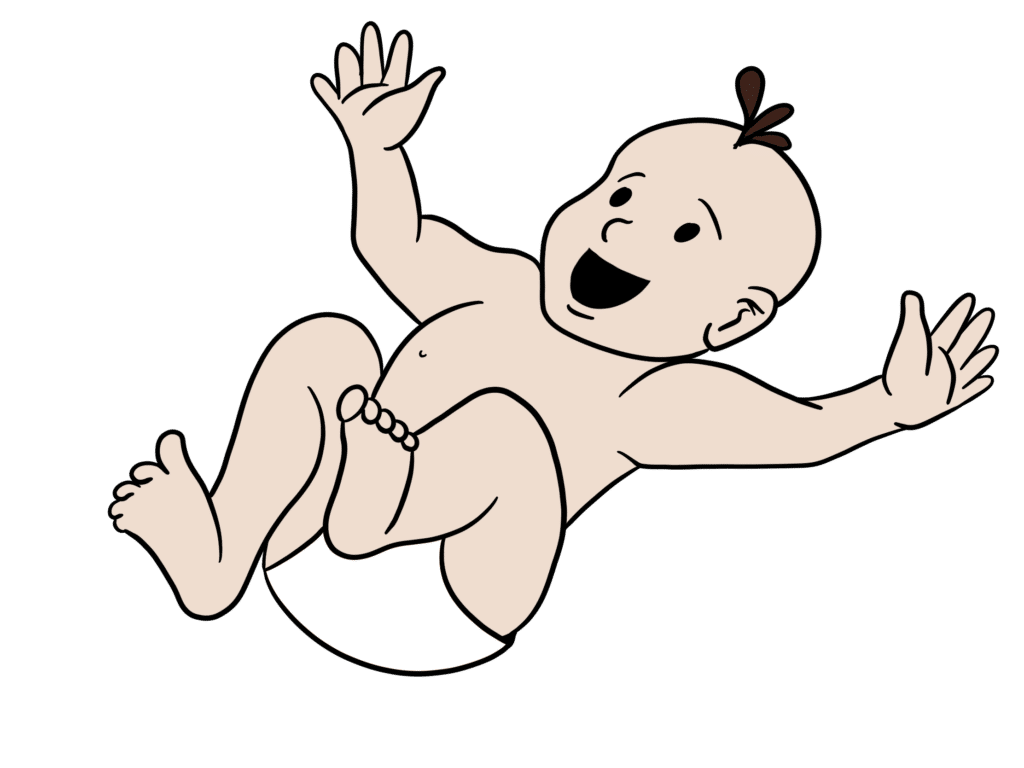
Phase 1: Arme und Beine strecken sich, der Brustkorb öffnet sich, Finger sind gespreizt – Einatmen.
Phase 2: Arme und Beine beugen sich, die Hände ballen sich zur Faust, der Körper geht in eine schützende Haltung – Ausatmen und häufig Weinen.
Auslösereize
Plötzliche Lageveränderungen (z. B. Zurückneigen des Kopfes oder ruckartiges “Fallenlassen”), laute Geräusche, grelles Licht oder unerwartete Berührungen können den Reflex aktivieren. Auch ein nicht integrierter Furcht-Lähmungs-Reflex (FLR) kann dazu führen, dass der Moro Reflex als übermäßige Reaktion auf Sinneseindrücke kompensatorisch aktiv bleibt.
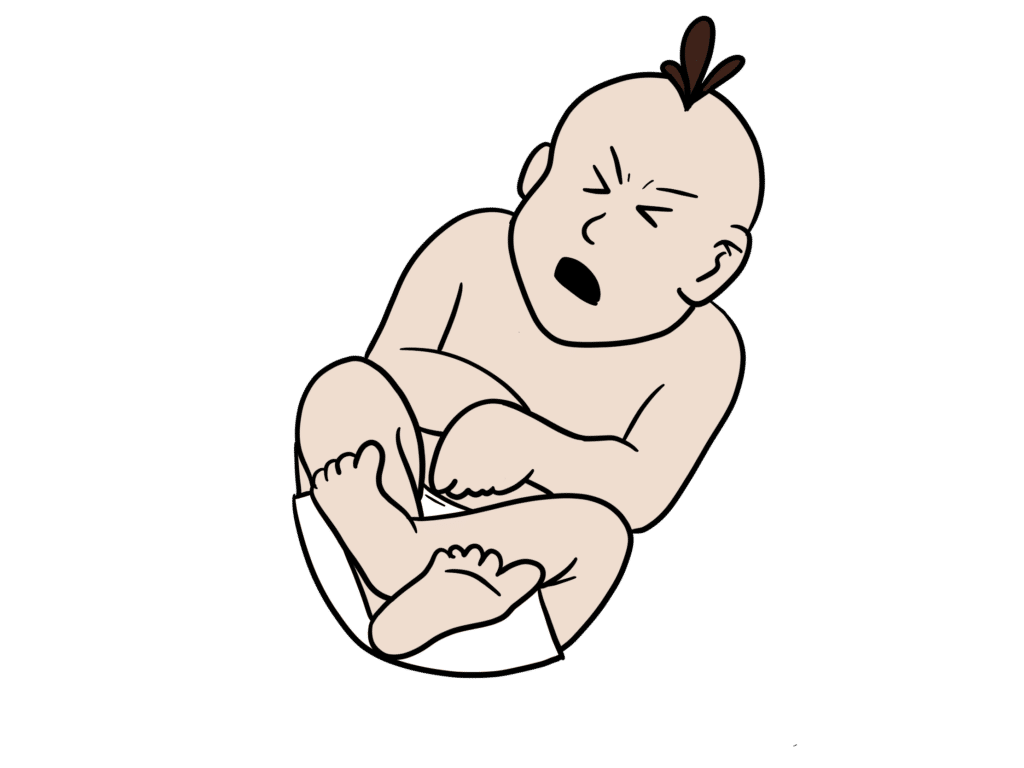
Neben starken und unangenehmen Stimulationen des Gleichgewichts-, Gehör- oder Sehsinns kann der Moro-Reflex auch durch eine Stimulation der Tiefensensibilität ausgelöst werden, wie zum Beispiel durch eine rasche Veränderung der Kopfposition, einen lauten Ton, einen erschreckenden visuellen Reiz, eine unangenehme Berührung oder eine plötzliche Lageveränderung.
Bedeutung für die Entwicklung
Der Moro-Reflex aktiviert den Sympathikus (Teil des autonomen Nervensystems) und unterstützt den Säugling dabei, auf Gefahr zu reagieren. Gleichzeitig ist er ein Startpunkt für die Entwicklung von Urvertrauen, Selbstregulation und emotionaler Bindung. Seine gesunde Integration bereitet den Weg für die Fähigkeit, mit Reizen, Stress und Emotionen angemessen umzugehen.
Der Reflex unterstützt im Mutterleib mit der Bewegung den Fötus beim Trainieren der Atemmuskeln, was essentiell für die weitere Entwicklung ist.
Was passiert bei Restaktivität (nicht integrierter Reflex)?
Bleibt der Moro-Reflex aktiv, bleibt das Nervensystem in ständiger Alarmbereitschaft.
Das Kind reagiert überempfindlich auf Reize und kann sich nur schwer regulieren. Diese Daueraktivierung des Sympathikus führt zu:
- Überempfindlichkeit gegenüber visuellen, auditiven, taktilen, vestibulären und tiefensensiblen Reizen
- Schwierigkeiten bei der Reizfilterung, z. B. laute Umgebungen oder visuelle Ablenkungen
- Erhöhtem Muskeltonus bei Stress, „ständiger Körperspannung“
- Überforderung des Gleichgewichtssystems → Unsicherheit bei Bewegung
- Schwierigkeiten mit emotionaler Selbstregulation
- Aktivierung von Angst- und Schutzmustern (z. B. Rückzug oder Überreaktion)
- Der Reflex bleibt unter Umständen noch im Erwachsenenalter auslösbar (z. B. durch Erschrecken)
Kinder mit einem aktiven Moro-Reflex reagieren oft viel intensiver auf alltägliche Situationen als andere. In Gesprächen mit Eltern zeigt sich immer wieder ein ähnliches Bild: Es gab Phasen mit häufigen Infekten, vergrößerten Polypen, starke Trotzreaktionen oder eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber ganz normalen Dingen. Besonders auffällig ist, dass scheinbar einfache Handlungen wie Zähneputzen, Haare kämmen oder Fingernägel schneiden zu emotionalen Ausnahmezuständen führen können. Was für andere Kinder eine kurze Routine ist, löst hier Stress, Diskussionen oder sogar Wutanfälle aus.
Was dahintersteckt: Beim nicht integrierten Moro-Reflex befindet sich das Nervensystem in einer Art Dauer-Alarmbereitschaft. Das bedeutet: Reize werden nicht gefiltert, sondern ungehemmt weitergeleitet – jede Berührung, jedes Geräusch, jede Lageveränderung wird verstärkt wahrgenommen. Das Gehirn bewertet selbst harmlose Impulse wie eine potenzielle Bedrohung – und reagiert entsprechend mit Abwehr oder Rückzug.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein leichtes Anstoßen auf dem Schulhof oder ein enger Pulli reichen schon aus, um ein Kind in Stress zu bringen – es reagiert möglicherweise mit Weinen, Rückzug oder Wut, weil der Körper sofort auf „Gefahr“ umschaltet.
Zum Nachempfinden: Stell dir vor, du sitzt für einige Minuten ganz still mit weit geöffneten Augen – wachsam, innerlich angespannt, ohne Ablenkung. Selbst ohne äußere Reize wirst du spüren, wie der Körper in Anspannung geht, der Puls steigt, vielleicht ein Kribbeln in der Haut entsteht. So ähnlich fühlt sich der Alltag für ein Kind an, dessen Nervensystem durch den Moro-Reflex permanent „auf Empfang“ steht.
Typische Anzeichen bei Restaktivität
Lernen & Aufmerksamkeit
- Konzentrationsschwierigkeiten, leicht ablenkbar
- Impulsives Verhalten, motorische Unruhe
- Schwierigkeiten beim Stillsitzen oder Zuhören
- Lese-Rechtschreib-Schwächen (z. B. LRS, Legasthenie)
- Visuelle Verarbeitungsprobleme (z. B. Fixieren, Verfolgen beim Lesen)
- Lese- und visuelle Verarbeitungsprobleme
- Impulsives Verhalten, mangelnde Frustrationstoleranz
- Schwierigkeiten mit Veränderungen, mangelnde Flexibilität
Emotion & Verhalten
- Überreaktionen auf Stress oder Veränderungen
- Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen
- Vertrauensprobleme und geringe Frustrationstoleranz
- Übererregtheit durch Reize (Geräusche, Licht, Bewegung)
- Schwierigkeiten in der sozialen Anpassung
- Ängstlichkeit, Panik, psychosomatische Beschwerden (z. B. Bauchweh, Kopfschmerzen)
- Phasenweise Hyperaktivität oder Übermüdung
- Tendenz zu Zwangsverhalten, starkes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur
- Kritikunfähigkeit, geringes Selbstwertgefühl
Körper & Gesundheit
- Häufige Infekte, Allergien, schwaches Immunsystem
- Schlechte Balance, Gleichgewichtsprobleme
- emotionale „Schwankungen“
- Schlafprobleme, chronisch erhöhter Stresspegel
- Licht- und Geräuschempfindlichkeit
- Probleme mit Gleichgewicht, Koordination, Reisekrankheit
- Überempfindlichkeit auf Berührung oder Lagewechsel
- Tendenz zum Schielen
- Übermäßige Anspannung bei plötzlicher Bewegung oder Nähe










