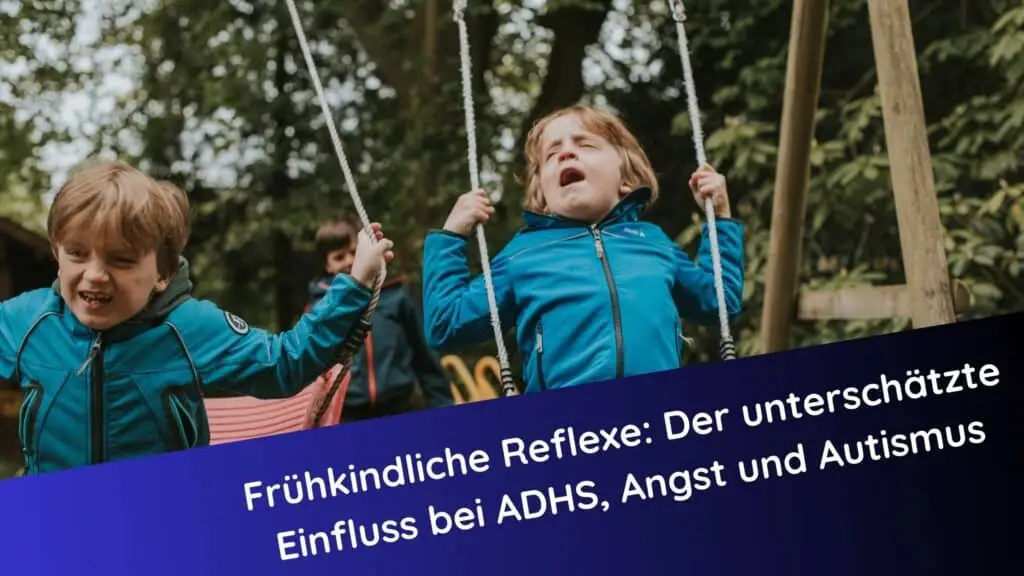Vor ein paar Tagen lernte ich Ben kennen. Ben ist acht Jahre alt, schmal gebaut. Seine Hände waren fest ineinander verschränkt und seine Füße wippten unaufhörlich. Immer wieder huschte sein Blick zur Tür, dann zu mir, dann auf den Boden. Er wirkte angespannt – aber auch bemüht, „alles richtig zu machen“.
Seine Mutter hatte am Telefon viel erzählt: von den Wutausbrüchen, der ständigen Unruhe, der ADHS-Diagnose. Von der Angst, dass Ben in der Schule irgendwann „durchrutscht“. Und dass sie als Eltern immer wieder hören, er solle sich halt etwas mehr anstrengen. In Bens Klasse gibt es einige Kinder, die durch ihr Verhalten “auffallen”, also das Lernen für die ganze Klasse erschweren und den Lehrer sehr fordern. Ben ist einer von ihnen.
Ich beobachtete Ben, wie er sich bewegte, wie er versuchte, still zu sitzen. Und wie sein Körper – ganz unabhängig von seinem Willen – immer wieder in Bewegung ging.
Und ich wusste sofort: Wir müssen bei den frühkindlichen Reflexen anfangen.
Das erwartet dich in diesem Beitrag
Was sind frühkindliche Reflexe – und warum können sie später zum Problem werden?
Frühkindliche Reflexe sind automatische Bewegungsmuster, die Babys dabei helfen, zu überleben. Sie entstehen im Hirnstamm – also in dem Teil des Gehirns, der reflexhaft reagiert, noch bevor der bewusste Verstand überhaupt „mitreden“ kann.
Ein Beispiel: Wenn ein Neugeborenes plötzlich erschrickt, streckt es die Arme ruckartig seitwärts nach oben. Das ist der Moro-Reflex. Oder der Greifreflex: Lege deinen Finger in die Hand eines Säuglings, und seine kleinen Finger schließen sich sofort darum. Diese Reflexe sind wichtig – in den ersten Lebensmonaten.
Aber: Im Laufe der kindlichen Entwicklung sollten sie durch reifere Bewegungs- und Regulationsmuster ersetzt werden. Genau das passiert allerdings nicht bei allen Kindern. Manche dieser Reflexe bleiben unbewusst aktiv – und genau das kann zu Herausforderungen führen.
Was passiert, wenn frühkindliche Reflexe aktiv bleiben?
Der Körper reagiert dann, als sei er ständig in Alarmbereitschaft. Und das hat Folgen – ganz besonders bei Kindern mit ADHS, Angststörungen oder einer Autismus-Spektrum-Störung (Stufe 1).
1. Frühkindliche Reflexe und ADHS: Wenn der Körper zu schnell reagiert
Bei vielen Kindern mit ADHS beobachten wir eine auffällige Bewegungsunruhe – die aber nicht „absichtlich“ ist. Der persistierende Moro-Reflex etwa sorgt für eine erhöhte Reizempfindlichkeit: Das Kind ist dauerhaft im Alarmmodus. Auch der Tonische Labyrinth-Reflex kann erhalten bleiben – das erschwert die Impulskontrolle, weil der Körper auf Bewegungsreize nicht angemessen reagieren kann.
Das bedeutet: Die Kinder wollen sich regulieren, sie wollen still sitzen, sich konzentrieren und den Erwartungen, die an sie gestellt werden, entsprechen – aber ihr Nervensystem ist überfordert. Nicht wegen mangelnder Disziplin, sondern weil es neurologisch schlicht nicht gelingt. Sie können einfach nicht!
2. Frühkindliche Reflexe und Autismus: Wenn Reize zu viel werden
Bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Stufe 1) beobachten wir oft ein Ungleichgewicht in der Gehirnentwicklung: Die linke Hemisphäre ist überaktiv, die rechte unterentwickelt. Genau dort – in der rechten Gehirnhälfte – sitzen aber viele der Fähigkeiten, die wir für emotionale Selbstregulation, Empathie und Körperwahrnehmung brauchen.
Wenn dann noch frühkindliche Reflexe aktiv sind, verschärft das die Reizüberflutung und die Schwierigkeiten in der motorischen Koordination. Das ist kein Erziehungsproblem – sondern eine neurologische Herausforderung, die gezielt trainierbar ist.
3. Frühkindliche Reflexe und Angst: Wenn das Gehirn nicht „ausschalten“ kann
Ein besonders spannender Zusammenhang zeigt sich bei Angststörungen. Der orbitofrontale Cortex – genauer: der rechte Teil davon – hilft uns dabei, Angst zu hemmen. Wenn dieser Bereich nicht stark genug aktiviert ist, bleibt das Gehirn in einem Zustand von „Gefahr“. Das kann durch aktive frühkindliche Reflexe verstärkt werden, denn sie blockieren die Reifung eben dieser Hirnregion.
In der Praxis sehen wir das oft bei sensiblen, überangepassten Kindern – oder bei Kindern, die „wie aus dem Nichts“ in starke Angstreaktionen rutschen.
Warum AAIM Reflexintegration so ein starker Hebel ist
Die gute Nachricht: Das alles ist veränderbar.
Das Nervensystem ist formbar – lebenslang. Und das bedeutet: Wir können auch mit älteren Kindern (und Erwachsenen!) daran arbeiten, frühkindliche Reflexe zu integrieren. Nicht durch Druck, nicht durch Verhaltenstraining, sondern durch gezielte, sanfte Bewegungen, die dem Gehirn helfen, nachzureifen.
Denn Verhalten ist nicht immer „absichtlich“. Manchmal ist es einfach neurologisch erklärbar – und veränderbar.
Weiterführende Beiträge
- Was ist hier eigentlich los? ADHS erkennen, verstehen, verändern
- Was ist Reflexintegration? Und wie wirkt Reflexintegrationstraining?
- Reflexintegration – Risiken und Nebenwirkungen?! Typische Reaktionen und Begleiterscheinungen verstehen und sicher begleiten
- Wenn der Körper nicht loslassen kann – Wie restaktive frühkindliche Reflexe Ängste und Stress verstärken
- Was ist Reflexintegration? Und was ist der Unterschied zur Ergotherapie?